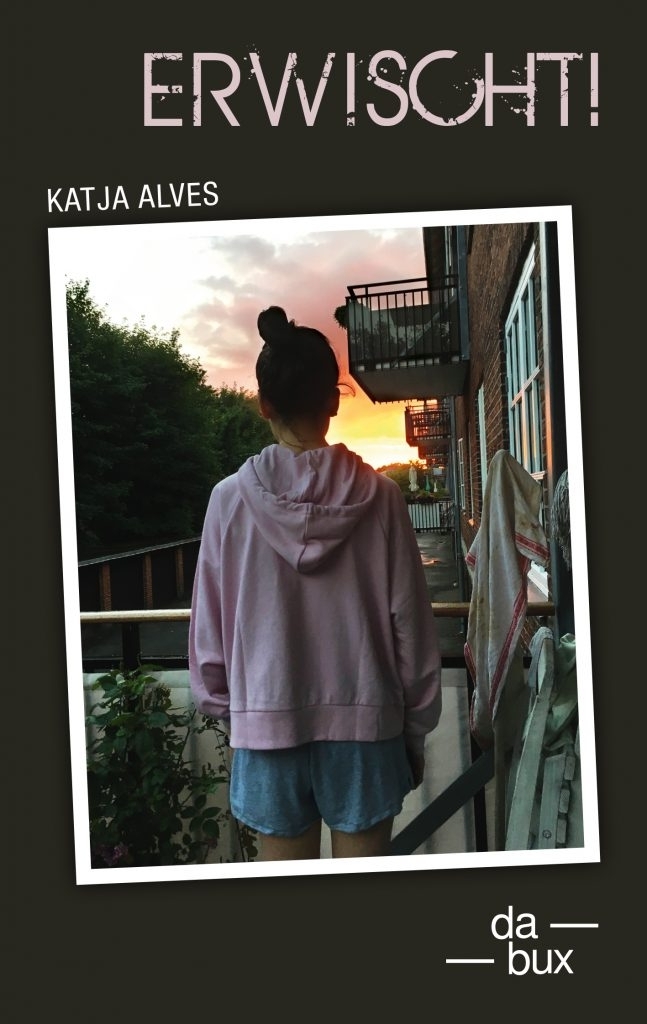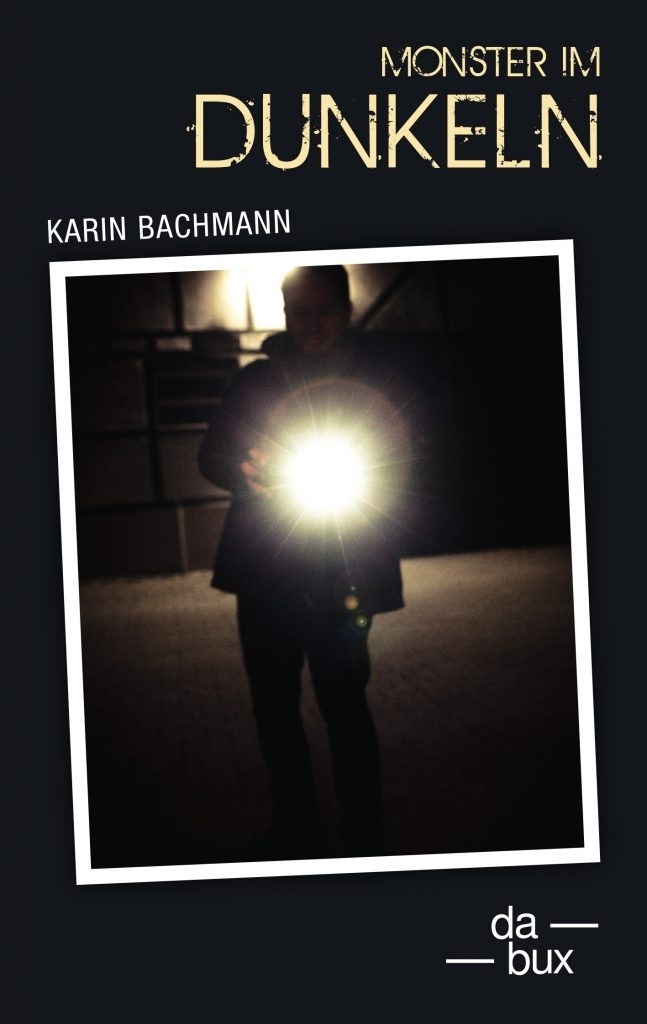Erstes Schweizer Coming-out-Jugendbuch macht Mut
In seinem Jugendbuch „Totsch“ erzählt der Aarauer Schriftsteller Sunil Mann die Comingout-Geschichte eines Schweizer Jugendlichen. Es ist das erste Schweizer Jugendbuch, das sich an dieses Thema heranwagt.
Olaf bezeichnet sich selbst als „Totsch“. Der Berufsschüler ist ein unbedarfter Trampel. Vor allem wenn es um die Suche nach sich selber geht. Oft spricht er, bevor er denkt und tritt immer wieder in ein Fettnäpfchen. Und da ist Yannick im Nachbarhaus, den Olaf schon seit einiger Zeit heimlich beobachtet. Sunil Mann hat sich einen besonderen Kniff einfallen lassen: In den ersten Kapiteln wird nicht deutlich, ob der Protagonist weiblich oder männlich ist. „Damit möchte ich sichtbar machen, dass dieses Sehnen nach jemandem bei allen gleich ist und auch gar nichts mit der sexuellen Orientierung zu tun hat.“ Der 47-Jährige Autor, geboren und aufgewachsen im Berner Oberland, hat sich bewusst entschieden, sein erstes Jugendbuch den Themen Identitätssuche, Sehnsucht und Coming-Out zu widmen: „Ich wollte über etwas schreiben, zudem ich einen persönlichen Bezug habe. Die Jugendlichen heute wachsen zwar in einer ganz anderen Zeit auf.“ Das Internet habe vieles einfacher gemacht. „Aber auch im Smartphone-Zeitalter sind Jugendliche, die mit ihrer sexuellen Orientierung nicht der Mehrheit entsprechen, noch immer mit den gleichen Herausforderungen konfrontiert.“
Über Vorurteile diskutieren
Sunil Mann wendet sich mit seinem Buch besonders auch an leseschwache Jugendliche. Er hat eine Sprache gewählt, die auch junge Leserinnen und Leser packt, die sich mit Lesen schwer tun. Das Buch ist nur 65 Seiten dick. Er hofft, dass das Buch auch als Klassenlektüre zum Einsatz kommt: „Es war schon immer eine große Chance, sich mit einer Geschichte einem Thema anzunähern“, so Sunil Mann, „statt Fakten und Theorie lernt man einen konkreten Menschen und seine Gefühle kennen. Ich hoffe, dass nach der Lektüre in den Klassen diskutiert wird: über Homosexualität, Vorurteile und Homophobie.“ Medienberichte zeigen, dass homophobe Beleidigungen und Übergriffe wieder zunehmen. Gerade deshalb sei es wichtig, in den Schulen das Thema nicht auszublenden, sondern darüber zu sprechen. „Ich bin froh, dass der Verlag zusätzlich als Download Arbeitsmaterial zum Buch und zu Homophobie anbietet, so bekommen die Lehrpersonen viele Anregungen, wie sie die Geschichte und das Thema bearbeiten können.“ Auch wenn noch immer ein Tabu, erlebe Sunil Mann, dass Jugendliche offen und interessiert seien, über sexuelle Identitäten zu sprechen. „Ich kann die Lehrpersonen nur ermutigen, das Thema aufzugreifen.“
Mutig statt melancholisch
Auf eines hat Sunil Mann, der sich schon als Autor von Erwachsenen-Krimis weit über die Schweizer Grenze hinaus einen Namen gemacht hat, besonders Wert gelegt: „Coming-out-Bücher und -Filme sind oft von einer bitter-süßlich-melancholischen Grundstimmung geprägt. Ich wollte eine ganz andere Geschichte erzählen: Mein Protagonist ist alles andere als eine Opfer-Figur. Er lässt sich nicht unterkriegen, ist selbstbewusst. Er weiß, was er will und steht mit beiden Beinen im Leben. Nicht die Frage der sexuellen Orientierung macht ihm zu schaffen, sondern dass die Person, zu der er sich hingezogen fühlt, unerreichbar scheint.“ Die Geschichte spielt in der Agglomeration von Zürich und schildert den Alltag von Schweizer Jugendlichen. Olaf, leicht übergewichtet, entspreche nicht dem typischen Rollenbild. „Wenn Vorurteile abgebaut werden sollen, ist es wichtig, Jugendliche mit unterschiedlichen Rolemodels zu konfrontieren.“